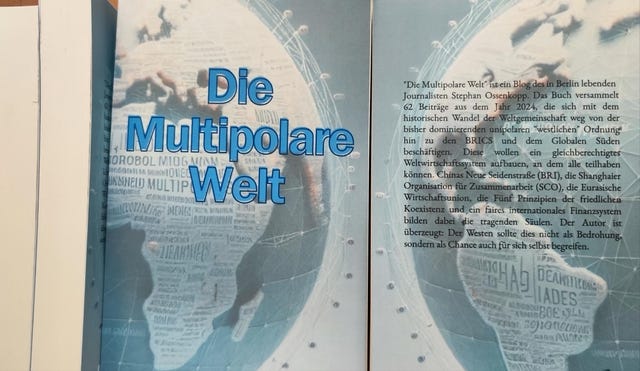Wer gewinnt in einer multipolaren Welt?
Halbwahre Analysen über den Globalen Süden und China - zwei Beispiele
Dieser etwas eigentümlich klingende Titel stammt aus einem Artikel in der amerikanischen Zeitschrift für internationale Beziehungen, Foreign Affairs. Sie erscheint seit 1922 in New York als Hauszeitschrift des Council on Foreign Relations (CFR), eines Think Tanks, der von elitären Bankiers und Politikern gegründet wurde. Was dort geschrieben steht, hält die liberale Machtelite für wert, beachtet zu werden. Der Artikel stammt von dem aus Brasilien stammenden Professor Matias Spektor, der unter der Überschrift “Der Aufstieg der Blockfreien” nachzeichnet, wie der zunehmende Einfluss des Globalen Südens angesichts eines durch Kriege, Finanzkrisen und Doppelmoral geschwächten Amerikas eine Welt mit mehr Unordnung und Konkurrenzkampf hervorbringen würde. Diese eher düstere Prognose muss nicht zwangsläufig eintreten. Vielmehr liegt es in der Axiomatik des Denkens der transatlantischen Eliten, dass der Niedergang ihrer Hegemonialmacht zwangsläufig zu mehr Chaos führen müsse. Multipolarität bedeutet für sie das Auseinanderbrechen einer bestehenden Ordnung, ohne dass sie dem Rest der Menschheit zutrauen, eine neue Ordnung zu schaffen, die im Interesse der Mehrheit funktioniert. Warum sollte nicht ein gerechteres, auf Interessenausgleich und gemeinsame Entwicklungschancen ausgerichtetes System das Ergebnis dieser historischen Transformation sein? Pessimistische Szenarien über den weiteren Verlauf der Geschichte sind auch in Deutschland gang und gäbe. "Make China Great Again" hieß es am 7. Februar im Handelsblatt. Das chinesische Modell biete Modernität und lehne "Verwestlichung" ab, und damit stehe der freiheitlich-demokratische Grundkonsens weltweit zur Disposition. Doch der Reihe nach.
Es ist erstaunlich, aber nicht widersprüchlich, dass die außenpolitische Elite in Washington zumindest selbstreflexive Analysen zulässt. Das jedenfalls scheint der Sinn des Essays von Professor Spektor in der ersten Ausgabe von Foreign Affairs des Jahres 2025 zu sein. Seine Analyse, der man eigentlich vorbehaltlos zustimmen kann, lautet in etwa so: Der globale Süden hat neue Kooperationsformen wie die BRICS, die Afrikanische Union und die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit geschaffen, um die Angelegenheiten der Weltgemeinschaft nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Sollten die USA mit Feindseligkeiten wie Zinserhöhungen, Handelshemmnissen, Sanktionen, Deportationen und dem Ausstieg aus multilateralen Verträgen reagieren, würde dies die Länder nur zu einer noch engeren Zusammenarbeit drängen. Ihre Bevölkerungen sind heute viel stärker politisch mobilisiert und technologisch befähigt als früher. Deshalb werden Alternativen zur US-Währung, nicht auf Dollar basierende Zahlungssysteme, digitale Währungen und Handelsmechanismen mit regionalen Abwicklungsmöglichkeiten weiter vorangetrieben. Und vor allem: Die Heuchelei und Doppelmoral des Westens mit seiner Untätigkeit in der Sache der Palästinenser zeigt der globalen Mehrheit, dass es mit der Integrität der liberalen internationalen Ordnung nicht weit her ist. Der Westen muss jetzt seine aggressive Außenpolitik der unipolaren Machtentfaltung zurücknehmen. Die Entwicklungsländer werden weiterhin China und Russland als entscheidende Machtzentren betrachten und ihre Chancen zur wirtschaftlichen, sicherheitspolitischen und technologischen Zusammenarbeit nutzen, erklärt Spektor.

Auch die Gründe für die Haltung der Länder des Globalen Südens hat der Autor recht unverblümt aufgezählt: Mitte des 20. Jahrhunderts versuchte eine Koalition des Globalen Südens unter dem Banner der Blockfreien Bewegung das imperiale Erbe ihrer europäischen Kolonialherren zu zerschlagen und kämpfte für Souveränität, Gleichheit, wirtschaftliche Gerechtigkeit und kulturelle Befreiung vom westlichen Einfluss. Im Ergebnis wurde die Entkolonialisierung völkerrechtlich verankert und das Prinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten zur globalen Norm. Doch der Westen, insbesondere die USA, hätten die Blockfreien und den Globalen Süden als obsolet abgetan. Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds setzten finanzielle Deregulierung und Austeritätspolitik durch. Die Anwendung extraterritorialer US-Gesetze zum Abbau existenzieller Schutzmaßnahmen und Subventionen traf die Entwicklungsländer mit verheerenden Folgen für ihre noch nicht industrialisierten Volkswirtschaften. Und die Norm der Nichteinmischung haben die USA selbst verletzt, als sie 1999 unter Umgehung des UN-Sicherheitsrates gemeinsam mit der NATO Serbien bombardierten. (Übrigens: Jugoslawien gehörte 1961 zu den Gründungsmitgliedern der Bewegung der Blockfreien Staaten.)
Und weiter: Im Krieg gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verkündeten die USA, es gebe keine Regeln mehr. Die Invasionen in Afghanistan und im Irak forderten Millionen von direkten und indirekten Toten. Auch die Interventionen im Rahmen der “Schutzverantwortung” (responsibility to protect) in Libyen, Jemen und Syrien haben dort zu extremer Instabilität geführt und eine Massenflucht aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa ausgelöst. Die globale Finanzkrise von 2008 machte zudem erneut deutlich, dass die Grundpfeiler des liberalen internationalen Finanzsystems ziemlich morsch waren. Im globalen Süden wurde der Ruf nach einer neuen internationalen Struktur immer lauter. In der Folge bildeten sich mit den BRICS, der Afrikanischen Union, OPEC+, der Asian Infrastructure Investment Bank und anderen nicht-westlichen Institutionen kollektive Akteure des Globalen Südens. Am Ende seines Artikels verharrt der Autor jedoch in einer typisch linearen Denkweise. Washington werde seine Politik des wirtschaftlichen Zwangs, der diplomatischen Isolierung und sogar der militärischen Gewalt weitgehend fortsetzen. Der Globale Süden habe nicht die Geschlossenheit und die Ressourcen, um Trumps Außenpolitik vollends abzuwehren. Man könnte einwenden, dass diese Frage noch lange nicht entschieden ist.
Die Fünf Prinzipien
Damit kommen wir zum zweiten Beispiel: Wenn also das liberale transatlantische Modell durch eklatante Doppelmoral und mangelnde Anerkennung eines gleichberechtigten Globalen Südens an Glaubwürdigkeit und Anziehungskraft verloren hat, bleibt die Frage, welches Modell den benachteiligten Ländern am ehesten Orientierung geben könnte. Die Tatsache, dass sich inzwischen 150 Staaten der neuen Seidenstraße Chinas angeschlossen haben (auch wenn das mittelamerikanische Panama auf Druck des US-Außenministeriums vor kurzem seine Mitgliedschaft in der Seidenstraßen-Initiative aufgekündigt hat), ist ein klarer Ausdruck dieser Schwerpunktverlagerung weg vom transatlantischen Raum hin zum asiatisch-pazifischen Gebiet. Dabei geht es nicht zwingend um den Export eines “chinesischen Modells” in andere Staaten, sondern um ein individuelles Andocken zwischen China und den teilnehmenden Ländern mit ihren jeweils eigenen Entwicklungsvorstellungen. Die vom Weißen Haus angedrohten oder bereits verhängten Zölle gegen China und die BRICS-Gruppe beschleunigen diesen Prozess zusätzlich. Das ist sicher auch der Anlass, warum Zeitungen wie das Handelsblatt jetzt schreiben, dass Trumps Zollpolitik die meisten Länder der Welt davon überzeugt, mehr Distanz zu den USA und mehr Nähe zu China zu suchen. Strategisch Positives können sie dem aber auch nicht abgewinnen.
Der relativ neue China-Korrespondent Martin Benninghoff, der für das Handelsblatt aus Shanghai berichtet, hat in einem kürzlich erschienenen Sonderheft über diese Entwicklung geschrieben. Obwohl die Faktenlage korrekt geschildert wird, quält sich der Autor damit, das Gesamtbild zu einer finsteren antiwestlichen Verschwörung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und der Kommunistischen Partei Chinas zusammenzukleben. Die aufgezählten Fakten sehen so aus: Xi sprach bereits vor zwei Jahren vom unaufhaltsamen Niedergang des Westens, weil es diesem immer schwerer falle, „die Gier des Kapitals“ zu zügeln und „Krankheiten wie die Ausbreitung des Materialismus und geistige Armut“ zu beseitigen. Die entwickelten Länder der Welt seien bisher vor allem „europäisch, amerikanisch und kapitalistisch“ gewesen. Man habe den Menschen die Illusion gegeben, Modernisierung sei gleichbedeutend mit Verwestlichung. Das chinesische Modell eröffne den Entwicklungsländern Hoffnung und einen Weg zur Modernisierung, verstanden als „Suche der Menschheit nach einem besseren Gesellschaftssystem“. Der Westen und sein Modell stünden für eine „Phase der mutwilligen Plünderung der natürlichen Ressourcen“, die zu einer großen Kluft zwischen Arm und Reich und zu einer ernsthaften Polarisierung geführt habe. Soweit die von Benninghoff wiedergegebene Analyse von Xi Jinping, die keineswegs außergewöhnlich erscheint.
China im Visier des Westens
Das chinesische Modell muss sich an seinen Erfolgen messen lassen. Benninghoff, der selbst in China lebt und arbeitet, spricht in dem Artikel von beeindruckend neu gebauter Infrastruktur wie Brücken, Straßen, Bahnhöfen und Flughäfen. Und von chinesischen Autos als rollenden Smartphones mit umfassender Konnektivität, die ihren europäischen Konkurrenten davonfahren. Er erwähnt den bahnbrechenden Erfolg des KI-Modells von Deep Seek und die Erschütterung der amerikanischen Tech-Szene. Ebenso spricht er davon, dass der chinesische Präsident Xi Begriffe wie "chinesische Zivilisation", "chinesische Kultur" oder "traditionelle Kultur" viel häufiger verwendet als seine Vorgänger. Der Handelsblatt-Autor zitiert auch den China-Kenner und ehemaligen australischen Premierminister Kevin Rudd mit den Worten, für Xi sei der „chinesische Traum“, also die Verwirklichung einer Art chinesischer Renaissance, „der Schlüssel zu einem positiven alternativen Narrativ sowohl in China als auch in der Welt“. Das könnte man so stehen lassen und als begrüßenswerten historischen Prozess des friedlichen Aufstiegs einer Nation beschreiben. China, das selbst einst brutal kolonisiert wurde und Massaker durch Besatzer erlebte, das lange Zeit isoliert war, kehrt zu seiner Identität als Zivilisationsstaat mit Handel und Diplomatie zurück.
Aber nein, Benninghoff muss im letzten Absatz des Artikels - vielleicht redaktionelle Vorgabe, vielleicht psychologische Konditionierung - trotzdem alles schwarz sehen: zu niedrige Löhne, unterentwickelte Sozialsysteme, Immobilienkrise, volatile Aktienmärkte, gelähmter Konsum, Überalterung, mittelfristiger Fachkräftemangel und nachlassendes Wachstum. All dies deute auf den Abstieg Chinas hin - eine Deutung, die übrigens seit Jahrzehnten von einem Heer von Autoren erfolglos vertreten wird. Die Rhetorik vom "chinesischen Traum" sei nur ein Ablenkungsmanöver für den Fall, dass der Präsident seine eigenen Probleme nicht in den Griff bekomme. Der Verfasser sollte es besser wissen. Bei seiner Ankunft in Shanghai im Frühjahr 2024 betonte der Autor noch, wie sehr er sein Chinabild revidieren müsse, da er China nun mit seiner Familie authentisch erlebe. Aber offensichtlich schreibt er hier für ein westliches Publikum und muss die in der Mainstreampresse üblichen Untergangsszenarien wiederkäuen. Wenn man bedenkt, dass das Handelsblatt in erster Linie eine Wirtschaftszeitung ist, erweist es seinen Lesern seit geraumer Zeit einen Bärendienst.
Es gibt noch Taschenbücher “Die Multipolare Welt”, 288 Seiten, Selbstdruck
Bestell-Link: https://multipolarewelt.sumupstore.com/produkt/die-multipolare-welt